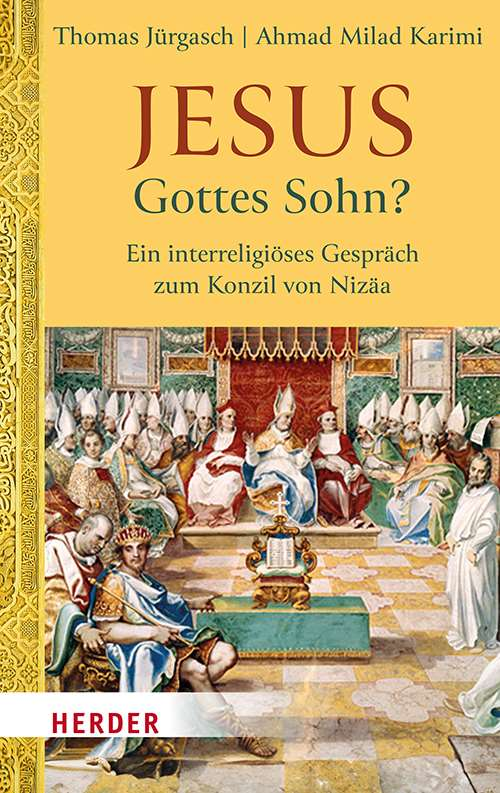
Thomas Jürgasch / Ahmad Milad Karimi
Jesus – Gottes Sohn? Ein interreligiöses Gespräch
zum Konzil von Nizäa
Freiburg/Br.: Herder 2025, 176 S.
– ISBN: 978-3-451-39866-7 –
Das Konzil im interreligiösen Dialog:
Leseprobe mit Inhaltsverzeichnis >>>
Verlagsinformation
Zum 1700. Jubiläum des Konzils von Nizäa, das formal und inhaltlich bis heute gültige Maßstäbe christlich-theologischen Denkens gesetzt hat, führen der christliche Theologe Thomas Jürgasch und der muslimische Theologe Ahmad Milad Karimi einen interreligiösen Dialog. Ziel ist es, die Bedeutung dieses wichtigen theologischen Konzils für die heutige Zeit und im Kontext eines interreligiösen Dialogs zu erschließen. Im Vordergrund steht das lebendige Gespräch über Grundfragen der Religion, deren Relevanz auch für die heutige Zeit und die damit verbundenen Herausforderungen aus dem Geist von Nicäa.
Worin besteht der Reiz dieser Form der Theologie? Inwiefern ist alles Theologische streitbar? Wie können sich christliche und islamische Theologien in der Gegenwart begegnen? Das Buch dient als Brücke zwischen den Religionen, indem es das historische Konzil von Nizäa als Ausgangspunkt für ein tiefgehendes, respektvolles und fruchtbares Gespräch zwischen Christentum und Islam eröffnet. Die Autoren zeigen durch ihren Dialog, dass trotz theologischer Unterschiede ein gemeinsames Streben nach Verständnis und Frieden möglich ist.
Vgl.
>>> Uta Heil / Jan-Heiner Tück (Hg.):
Nizäa – Das erste Konzil.
Historische, theologische und ökumenische Perspektiven
Freiburg u.a.: Herder 2025, 480 S. – >>> Details >>>
>>> Christentum weltweit – von den Anfängen bis heute (Blog-Archiv) >>>
Die Autoren
Thomas Jürgasch, Dr. theol., MSt. Oxon, geb. 1978, kath. Theologe,
Juniorprofessor für Alte Kirchengeschichte, Patrologie und Christliche Archäologie an der Eberhard Karls Universität Tübingen
>>> Mehr über Thomas Jürgasch (bei Herder ) >>>
>>> Mehr zu Thomas Jürgasch (Universität Tübingen)
Ahmad Milad Karimi, Dr. phil., geb. 1979 in Kabul, Islamwissenschaftler,
Studium der Philosophie, Mathematik und Islamwissenschaft in Darmstadt, Freiburg und Neu Delhi. Seit 2016 Professor für Kalām, islamische Philosophie und Mystik an der Universität Münster.
>>> Mehr über Ahmad Milad Karimi (bei Herder) >>>
Materialzusammenstellung zu Ahmad Milad Karimi (Interreligiöse Bibliothek [IRB] – Blog-Archiv –
Kommentar zum Buch von
Prof. Dr. Dr. Peter Antes, Hannover
(Yggdrasil-Liste, Uni Marburg, 01.09.2025)
Anlass für dieses höchst lesenswerte Buch ist das Konzil von Nizäa, das 325 n.Chr., also vor genau 1700 Jahren, auf Einladung von Kaiser Konstantin in Nizäa, in der Nähe von Izmir in der heutigen Türkei gelegen, stattgefunden hat und mit seinem Glaubensbekenntnis zu Jesus als „Sohn Gottes“ für die christlichen Kirchen des Abendlandes bis heute gültig ist. Wörtlich heißt es in diesem Glaubensbekenntnis:
„(1) Wir glauben an <den> einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren,
(2) und an <den> einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, als Einziggeborener aus dem Vater gezeugt, das heißt aus dem Wesen (ek tes ousías) des Vaters, Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen (gennethénta ou poietenta), wesensgleich dem Vater (homooúsios); durch den alles geworden ist, was im Himmel und was auf der Erde ist; der wegen uns Menschen und um unseres Heiles willen herabgestiegen und Fleisch und Mensch geworden ist, gelitten hat und auferstanden ist am dritten Tage, hinaufgefahren ist in die Himmel, und kommt, Lebende und Tote zu richten;
(3) und an den Heiligen Geist.“ (zit. S. 151)
Wer dem nicht zustimmt, ist nicht „orthodox“, d.h. hat nicht den rechten Glauben: dies gilt durch Nizäa bereits für die Arianer und auch – für uns Heutige wohl noch wichtiger – für die Muslime.Deshalb ist es bemerkenswert, dass in dem hier vorgestellten Buch ein interreligiöses Gespräch zwischen dem katholischen Theologen Thomas Jürgasch, Juniorprofessor für Alte Kirchengeschichte, Patrologie und Christliche Archäologie an der Eberhard Karls Universität Tübingen, und dem Muslim Ahmad Milad Kirmani, Professor für Kalam, Islamische Philosophie und Mystik an der Universität Münster, geführt wird. Der interreligiöse Dialog ist für die beiden Autoren unabdingbar.
„Weil Religion niemals für sich ist. Wir glauben, denken, leben nicht in Isolation, sondern immer im Antlitz des Anderen. Der christliche Glaube hat sich von Anfang an in Auseinandersetzung mit jüdischen, hellenistischen und römischen Denkweisen entfaltet, der Islam in der Begegnung mit jüdischen, christlichen und persischen Traditionen. Religionen existieren nicht außerhalb der Geschichte, sondern in ihr, durch sie, mit ihr. Wer den interreligiösen Dialog verweigert, verweigert die Geschichte, in der sein eigener Glaube gewachsen ist.
Doch es geht nicht nur um die Vergangenheit. In unserer Gegenwart, die geprägt ist von Missverständnissen, Konflikten und identitären Abschottungen, ist das Gespräch zwischen den Religionen notwendiger denn je. Es ist notwendig, weil wir nicht nur über den anderen sprechen dürfen, sondern mit ihm. Weil wir nicht nur unsere eigenen theologischen Traditionen bewahren können, wenn wir uns mit ihnen beschäftigen, sondern auch, indem wir sie der Herausforderung des anderen aussetzen. Jede Religion trägt eine Vielstimmigkeit in sich – eine Vielstimmigkeit, die nur erhalten bleibt, wenn wir nicht in Selbstgewissheit erstarren, sondern unermüdlich im Dialog bleiben, uns zu erklären, uns zu befragen, uns selbst infrage zu stellen.“ (S. 170)
Vorbildlich wird dieses Konzept sine ira et studio gut nachvollziehbar unter Bezug auf den gegenwärtigen Forschungsstand mit Blick auf die Fragen zum Konzil von Nizäa von den beiden Autoren umgesetzt. So wird die Vielstimmigkeit von Auslegungen und Positionen von Anfang an im Christentum (vgl. S. 100) wie im Islam (vgl. S. 100f) beschrieben und betont, dass in der Antike „das Konzept des Monotheismus keineswegs die Annahme der Existenz anderer Gottheiten bzw. göttlicher Wesen aus[schließt]“ (S. 23), man denke nur an die Weisheit oder den Logos als hypostasierte, d.h. zu einer Person gewordene Wirklichkeit.
Jürgasch stellt fest: „In der Forschung ist es mittlerweile Konsens, dass die Feststellung der Wesensgleichheit des Sohnes mit dem Vater nicht die für das nizänische Glaubensbekenntnis zentrale Bestimmung ist, sondern vor allem dazu dient, die gegen Arius gerichteten Spitzen nochmals zu verstärken“. (S. 157) Dieser hatte es nämlich explizit abgelehnt, „den Sohn als wesensgleich mit dem Vater zu bezeichnen, da diese [sic!] Bestimmung seines Erachtens eine materialistische Komponente innewohnt.“ (S. 158) Nach Arius ist der Sohn ein Geschöpf, „wenn auch nicht eines wie die übrigen Geschöpfe. Als solcher ist der Sohn, mit Arius gedacht, seinsmäßig abhängig vom Vater und daher nicht gleichrangig göttlich wie er.“ (S.155f) Als Muslim stimmt Karimi zu: „Jesus ist ein Geschöpf, ein besonderes, eine Art Sonderfall der Geschichte, wie es auch der Koran nahelegt, aber ein Geschöpf.“ (S. 127) Damit bestätigt Karimi Angelika Neuwirths Lesart der koranischen Christologie in „Der Koran als Text der Spätantike“ (Berlin: Verlag der Weltreligionen 2010) und folgt in etwa Günter Lülings These in „Die Wiederentdeckung des Propheten Muhammad“ (Erlangen: Verlag Lüling 1981), Muhammad sei der letzte Theologe des semitischen Christentums.
Mit dem Konzil von Nizäa und seiner Verurteilung des Arius war die Sache jedoch nicht erledigt, weshalb Konstantin 326 eine totale Kehrtwende seiner Religionspolitik vollzog, „da er Akteure wie Arius und Eusebius von Nikomedien innerhalb von nur zwei bis drei Jahren aus deren jeweiligem Exil zurückholte und stattdessen nun teilweise nizäatreue Bischöfe exiliert wurden.“ (S. 164) Als „Pontifex Maximus“, „eine Art Oberaufsicht über die für das Römische Reich relevanten Kulte“ (S. 80), war es sein erklärtes Ziel, „die Einheit der Christinnen und Christen und des christlichen Kultes zu bewahren bzw. herzustellen, um sich und dem Römischen Reich das Wohlwollen des christlichen Gottes zu sichern.“ (S. 164)
Das Buch zeigt nach Karimi deutlich, „dass sowohl im Christentum als auch im Islam Glaubensüberzeugungen selten einfach ‚feststehen‘, sondern in geschichtlichen Bewegungen entstehen, geformt durch politische Konstellationen, philosophische Ideen und spirituelle Erfahrungen. Was später als Dogma erscheint, ist oft Produkt lebendiger Auseinandersetzungen – und bleibt bei aller normativen Kraft, immer auch ein Kind seiner Zeit. Und genau das ermutig mich, dass der Dialog der Religionen und Konfessionen wichtig und fruchtbar ist, um nicht nur den anderen, deren Geschichte und Theologie zu verstehen, sondern auch sich selbst im Angesicht des anderen besser und genauer zu fassen.
Schließlich zeigt sich: Die radikale Differenzierung, die heute zwischen Konfessionen, Strömungen oder gar Religionen vorausgesetzt wird, war in der Frühzeit erst im Entstehen begriffen. Die Frage nach der Universalität des Glaubens – im Sinne eines für alle geltenden Glaubens – war kein Ausgangspunkt, sondern ein umkämpftes Ziel.“ (S. 167)
Es ist meine Hoffnung, die wenigen Hinweise mögen ausreichen, um möglichst viele anzuregen, das Buch zu lesen und dem Beispiel eines solchen intereligiösen Dialoges zu folgen.


